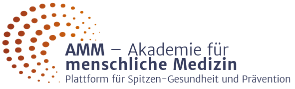- Diagnose Rheuma – wie kann die Ernährung helfen? (Teil II) - 17. Mai 2022
- Diagnose Rheuma – wie kann die Ernährung helfen? (Teil I) - 22. März 2022
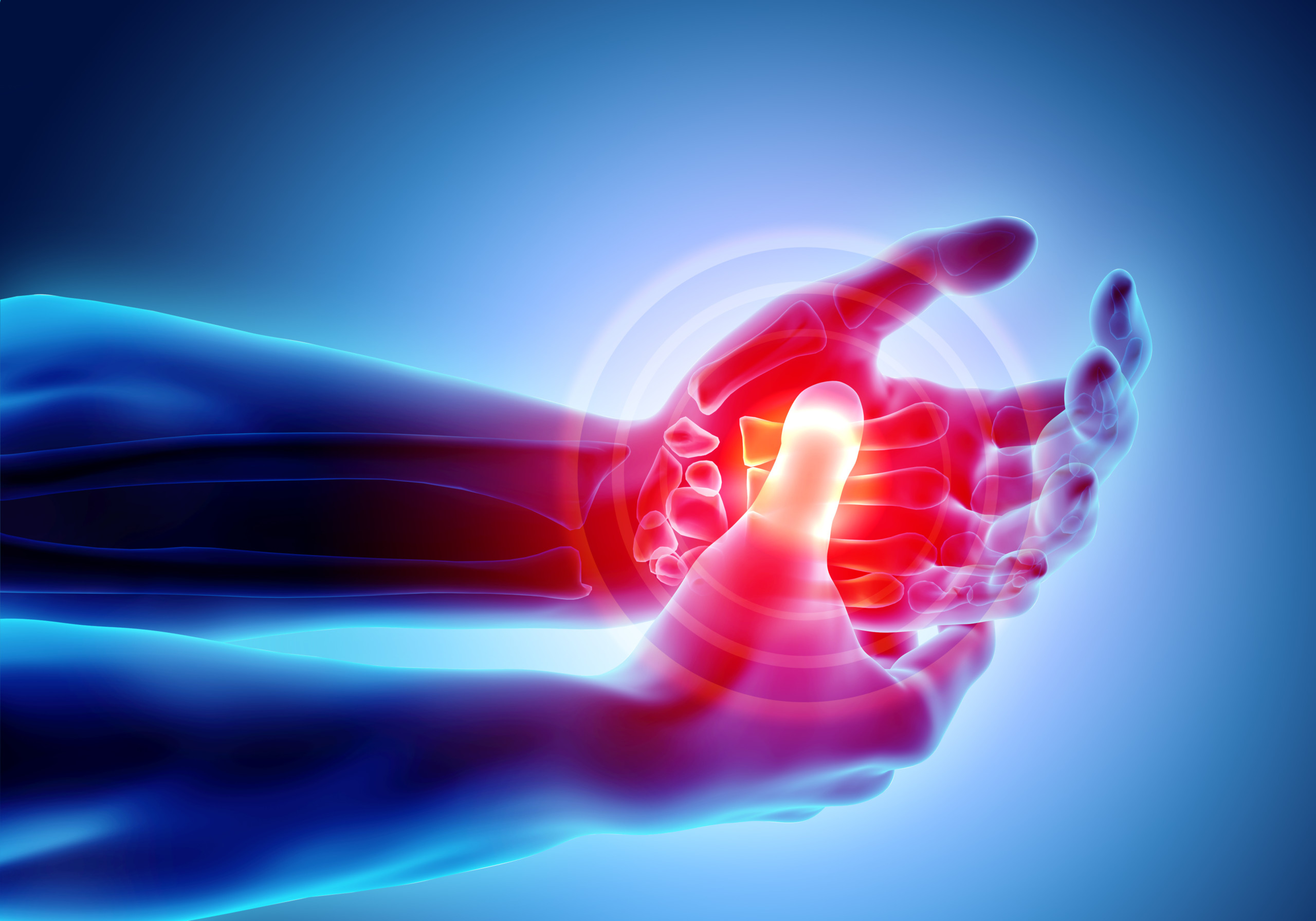
Inhaltsverzeichnis
Vor einigen Wochen haben wir uns an dieser Stelle bereits mit dem Krankheitsbild der rheumatischen Leiden beschäftigt. Über 100 Diagnosen fallen in diese Kategorie, 25 % der deutschen Bevölkerung sind von einer rheumatischen Erkrankung betroffen.
In Teil I von „Diagnose Rheuma – wie kann die Ernährung helfen?“ stand die Frage im Mittelpunkt, welchen Einfluss Kohlenhydrate und Blutzuckerspitzen auf rheumatische Beschwerden haben. Es gibt jedoch noch eine Reihe anderer ernährungsbedingter Faktoren, die bei einer rheumatischen Erkrankung beachtet werden sollten. Diesen Einflüssen widmet sich der zweite Teil des Textes.
Auch wenn rheumatische Erkrankungen in der Regel ein Leben lang bestehen bleiben, so kann durch die Optimierung der Ernährung und des Lebensstils eine erhebliche Verbesserung der Symptome und insbesondere auch der Begleiterkrankungen erzielt werden. Dies erfordert allerdings auch ein echtes Umdenken und die Identifizierung einer individuell optimierten Ernährungsstrategie.
Teil II: Rheumatische Beschwerden gezielt durch die Ernährung lindern
Lautet die Diagnose Rheuma, ist es mit der Einnahme einzelner Antioxidantien oder anderer „Wundermittel“ in der Regel nicht getan. Wenn man die individuellen Faktoren, die zur Krankheitsaktivität beitragen aber identifiziert hat, kann sehr wohl eine Strategie ausgearbeitet werden, mit der langfristig die Krankheitsaktivität reduziert und den Krankheitsschüben entgegengewirkt werden kann.
Diagnose Rheuma: Den erhöhten Nährstoffbedarf berücksichtigen
Doch zunächst sollte berücksichtigt werden, dass die Verdauung, die Leber sowie gesunde Darmbakterien (das Mikrobiom) in ihrer Funktion oft beeinträchtigt sind. Der Bedarf an Vitaminen und Mineralien, essenziellen Aminosäuren und Fettsäuren ist bei Rheuma-Patienten erhöht, gleichzeitig ist die Aufnahme oft gestört. Ursache sind hierfür sowohl Veränderungen durch die Erkrankung selbst als auch unerwünschte Nebeneffekte in Folge der oft notwendigen Medikamenteneinnahme. Die vierteilige Serie „Arzneimittel als Mikronährstoffräuber“ widmet sich detailliert diesem Thema und gibt Hilfestellungen bei der Frage, was es bei dauerhafter Medikamenteneinnahme in Bezug auf den Nährstoffhaushalt zu beachten gilt.
Adressieren lassen sich diese Probleme durch eine Ernährung auf Basis möglichst unverarbeiteter und natürlicher Lebensmittel bei gleichzeitigem Verzicht auf Zucker, Alkohol und Fertigprodukte. Allerdings sollte bedacht werden, dass nicht alle Vitamine, Mineralien und essentiellen Fettsäuren in ausreichender Menge über die Nahrung aufgenommen werden können. Eine individualisierte Optimierung der Ernährung in Kombination mit notwendigen Nährstoffpräparaten ist daher empfehlenswert. Dabei sollte bei der Dosierung natürlich auch der aktuelle Stand der Forschung berücksichtigt werden. Die Empfehlungen zur Einnahme von Supplementen liegen hier meist deutlich höher, als es die offiziellen Richtlinien der Fachgesellschaften anzeigen.
Ernährungszyklen einhalten und Entzündungen reduzieren
Pausen zwischen den Mahlzeiten von mindestens vier Stunden und ein Verzicht auf Essen und kalorienhaltigen Getränken über Nacht von mindestens 12 Stunden sind günstig für die Verdauung, entlasten die Leber und reduzieren Entzündungen im Körper. Unverarbeitete Lebensmittel und viel Gemüse wirken sich positiv auf das Mikrobiom und die Leber aus. Auch enthält diese Ernährungsform besonders viele Vitamine und Mineralien und wenig Zusatzstoffe, welche die Leber, das Mikrobiom und den Darm schädigen können. Durch diese Ernährungsweise lässt sich also ein solides Fundament legen, um den Körper bestmöglich dabei zu unterstützen, wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu kommen.
Individuelle Beratung von Experten in Anspruch nehmen
Trotz all dieser Maßnahmen können einige Beschwerden wie Schmerzen und Verdauungsprobleme bestehen bleiben. Manchmal lassen sich auch bestimmte Empfehlungen aus gesundheitlichen Gründen nicht umsetzen. Dies liegt oft an unerkannten Problemen, die zunächst gelöst werden müssen, ehe die obige Strategie erfolgreich angewendet werden kann.
Beispielsweise leiden viele Rheuma-Betroffene unter erheblichen Verdauungsstörungen, es kann eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Histamin, Fruktose oder eine Dünndarmfehlbesiedlung vorliegen. Sehr häufig lassen sich auch Unverträglichkeiten gegenüber „normalen“ Lebensmitteln wie dem Kuhmilchprotein beobachten. Ursache sind auch hier wieder krankhafte Veränderungen und Störungen, z.B. des Verdauungssystems, aber auch Medikamenteneinnahmen.
Diese Probleme können dann trotz Ernährungsumstellung zu Entzündungen und Beschwerden führen und dazu beitragen, dass der Eindruck entsteht, die Ernährungsumstellung habe nichts bewirkt.
Um dies zu vermeiden und eine individuell optimierte Ernährungsstrategie zu identifizieren, müssen diese Probleme und Ursachen für die Beschwerden beachtet und korrigiert werden. Daher macht es bei einem solch komplexen Krankheitsbild wie den rheumatischen Erkrankungen oft Sinn, mit einem Spezialisten zusammenzuarbeiten.
Julia Specks ist promovierte Molekularbiologin und funktionelle Beraterin zum Thema Stoffwechsel, Immunsystem & Ernährung. Als Mitglied in unserem AMM-Partnernetzwerk bietet Ihnen Frau Specks unter anderem eine Online-Beratung zur Ernährungs- und Lebensstiloptimierung bei rheumatischen Erkrankungen an.
Bereits erschienen:
Teil I von „Diagnose Rheuma – wie kann die Ernährung helfen?“
Weitere Ressourcen:
Podcast mit Julia Specks:
Webseite von Julia Specks mit wichtigen Ernährungsgrundlagen
Jetzt Ticket sichern: Die AMM lädt am 3. und 4. September zum Kongress für menschliche Medizin 2022 an den Campus Riedberg der Goethe Universität Frankfurt/Main. Thema in diesem Jahr: Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Für die limitierten Tickets gibt es bis zum 24. Juli 2022 einen Frühbucher-Rabatt!
Titelbild:
yodiyim / stock.adobe