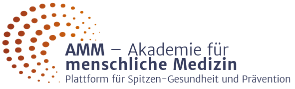- Coliforme Bakterien im Trinkwasser – Was bedeutet das für unsere Gesundheit? - 29. April 2025
- „Ganzheitlich denken, individuell behandeln“ – Dr. Ulrich Frohberger im Spitzen-Gespräch - 25. April 2025
- Effektive Regeneration im Schlaf - 24. April 2025

Trinkwasser zählt zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln in Deutschland. Umso größer ist die Verunsicherung, wenn in einer Probe plötzlich coliforme Bakterien nachgewiesen werden. Doch was bedeutet das genau – und wie kommen diese Bakterien überhaupt ins Trinkwasser?
Was sind coliforme Bakterien?
Coliforme Bakterien sind eine Gruppe verschiedener Bakterienarten, die zur Familie der Enterobacteriaceae gehören. Sie kommen natürlicherweise in der Umwelt sowie im Verdauungstrakt von Menschen und Tieren vor – sowohl als nützliche Mikroorganismen als auch in Formen, die unter bestimmten Umständen problematisch werden können.
Einige coliforme Arten gelten als harmlos und sind Bestandteil einer gesunden Darmflora. Andere wiederum, wie etwa bestimmte Stämme von Escherichia coli (E. coli), können Infektionen auslösen – insbesondere dann, wenn sie über verunreinigtes Wasser aufgenommen werden. Auch Enterokokken, Salmonellen oder sogenannte EHEC-Erreger zählen zu den bekannten Vertretern mit potenziellem Risiko.
Die Pathogenität von E. coli hat sich laut einer Studie der Medizinischen Hochschule Hannover im Laufe der Jahre erhöht – die Bakterien zeigen eine zunehmende Neigung, Krankheiten auszulösen (Kaper et al., 2004).
Wie gelangen coliforme Bakterien ins Trinkwasser?
Die Wege, auf denen coliforme Keime ins Trinkwasser gelangen können, sind vielfältig. Besonders nach Starkregen, Hochwasser oder technischen Störungen im Wassernetz kann es zu einer erhöhten Belastung kommen.
Wenn der Boden durch heftige Niederschläge gesättigt ist, kann Oberflächenwasser mit tierischen oder menschlichen Ausscheidungen in Kontakt kommen. Gelangt dieses Wasser in Brunnen oder beschädigte Leitungen, besteht die Gefahr, dass coliforme Bakterien ins Trinkwassersystem eingeschwemmt werden.
Auch die Nähe zu Güllegruben, Siloanlagen oder das Ausbringen von Jauche und Mist in der Umgebung von Wasserquellen kann zur Verunreinigung führen – besonders dann, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen fehlen oder nicht ausreichen.
Warum ist ihr Nachweis bedenklich?
Laut deutscher Trinkwasserverordnung dürfen coliforme Bakterien im Trinkwasser nicht nachweisbar sein. Ein Befund bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Wasser gesundheitsschädlich ist – aber er gilt als Hygieneindikator und weist auf eine mögliche Verunreinigung hin.
Mehrere Studien zeigen, dass E. coli im Trinkwasser mit einem erhöhten Risiko für Durchfallerkrankungen verbunden ist. Eine systematische Übersichtsarbeit fand beispielsweise einen deutlichen Zusammenhang zwischen E. coli-Nachweis und erhöhten Fallzahlen von Durchfall – insbesondere in Haushalten mit Kindern (Bain et al., 2014).
Besonders für kleine Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem kann eine Belastung mit bestimmten coliformen Erregern problematisch werden – insbesondere dann, wenn das Wasser nicht nur getrunken, sondern ungekocht auch für die Zubereitung von Speisen oder zum Duschen verwendet wird.
Ein weiteres Risiko ergibt sich durch zunehmende Antibiotikaresistenzen: Verschiedene Studien haben gezeigt, dass coliforme Bakterien – darunter auch E. coli – Resistenzen gegen gängige Antibiotika entwickeln können (Schmiege et al., 2023, Muhumuza et al., 2024).
Wie reagieren die Behörden?
Wenn bei einer Routinekontrolle coliforme Bakterien im Leitungswasser festgestellt werden, wird umgehend reagiert: In der Regel erfolgt eine behördliche Warnung mit dem Hinweis, das Wasser vor der Verwendung abzukochen – nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Waschen von Obst, Gemüse und Händen.
Darüber hinaus setzen Wasserversorger verstärkt auf Desinfektionsmaßnahmen, etwa durch die Zugabe von Chlor. Diese Methode ist zwar effektiv, bringt aber mitunter Nachteile mit sich: Ein starker Chlorgeschmack oder -geruch sowie die Bildung möglicher Nebenprodukte im Wasser sind unerwünschte Begleiterscheinungen. Einzelne Studien weisen zudem auf mögliche Risiken durch Nebenprodukte der Chlorung hin (Richardson, 2003).
Was können Verbraucher tun?
In Situationen mit einer bekannten Verunreinigung empfiehlt es sich, Wasser mindestens fünf Minuten sprudelnd abzukochen. Auch der Einsatz zertifizierter Wasserfilter kann eine sinnvolle Ergänzung sein – insbesondere in Haushalten mit Säuglingen oder immungeschwächten Personen.
Langfristig spielen auch der Zustand der Hausinstallation sowie eine regelmäßige Wartung von Brunnen und Wasserleitungen eine wichtige Rolle, um das Risiko einer Belastung mit coliformen Keimen zu minimieren.
Fazit
Coliforme Bakterien sind in der Umwelt weit verbreitet – im Trinkwasser haben sie jedoch nichts zu suchen. Ihr Nachweis ist ein Signal dafür, dass Schutzmechanismen versagt haben könnten. Eine umgehende Reaktion durch die zuständigen Behörden sorgt dafür, dass mögliche Risiken rasch eingedämmt werden. Für Verbraucher bedeutet das in erster Linie: informiert bleiben, Hinweise ernst nehmen – und im Zweifel lieber einmal zu oft als zu wenig das Wasser abkochen.
AMM-Empfehlungen
misterwater® – einfach besseres Wasser
- Ihr Lebensmittel Nummer eins: reinstes energiereiches Trinkwasser nach dem Vorbild der Natur
- Frei von Kalk, Schwermetallen, Pestiziden, Herbiziden, Hormonen, PFOA, Mikroplastik u.v.m.
- Hochleistungswasser durch Anreicherung mit Sauerstoff oder Wasserstoff
Hier geht es direkt zur Homepage von misterwater® und hier zum misterwater®-Shop
Bei Bestellung einer Wasserfilteranlage oder beispielsweise eines Wasserstoffgerätes bei misterwater® erhalten Sie einen AMM-Kundenrabatt von 50 Euro mit dem Gutscheincode AMM-Wasser.
Beitragsbild von Jarun Ontakrai/Shutterstock.com